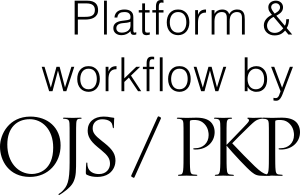Moderne Gesellschaft und Solidarität
DOI:
https://doi.org/10.18156/eug-1-2025-art-2Abstract
Solidarität zählt zu den zentralen Begriffen, die die politisch-normative Verständigung in Deutschland prägen. Zugleich ist Solidarität mit unterschiedlichen Bedeutungsgehalten versehen. Dadurch wird auch die Unterscheidung zwischen tätiger Nächstenliebe, Hilfestellungen im Kontext von Nahbereichsreziprozität und den Leistungen, die großformatige Organisationen und Institutionen zur Absicherung sozialer Risiken erbringen, aufgeweicht. Da die politische Kultur in Deutschland Fehlvorstellungen von Solidarität verinnerlicht hat, erscheinen soziale Prozesse von Institutionalisierung und Verrechtlichung zunehmend als moralisch fragwürdig. In diesem Kontext werden die nicht-verrechtlichte Verbundenheit und das nicht-verrechtlichte, reziproke Füreinander-Einstehen in sozialen Kleingruppen als moralisch hochstehend erachtet. Solidarität als deskriptiver Strukturbegriff und präskriptives Strukturprinzip zur politisch-normativen Orientierung großformatiger, anonymer Interdependenzen hat es hingegen schwer, als Solidarität anerkannt zu werden, und zieht immer wieder Kritik auf sich. Im Artikel »Moderne Gesellschaft und Solidarität« wird eine Typologie von Solidaritätsverständnissen vorgestellt, die die unterschiedlichen Verwendungsweisen des Solidaritätsbegriffs offenlegt. Ferner wird auf die ›Entdeckung‹ der Solidarität im 19. Jahrhundert als einer empirisch und normativ orientierenden wissenschaftlichen Vokabel eingegangen. Dabei kommen ausgewählte Theorieansätze des französischen Solidarismus zur Sprache, die die katholische Soziallehre beeinflusst haben. Die Emergenz hocharbeitsteilig strukturierter und funktional differenzierter moderner Massengesellschaften wird als Verstehenshintergrund für Solidarität plausibilisiert. Dies könnte helfen, einen oft missverstandenen Begriff erneut zu profilieren und in den politischen Arenen, in denen er zweifellos gebraucht wird, normativ scharf zu stellen.