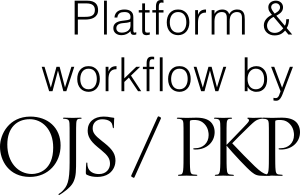Archive - Seite 2
-

Demokratie und Gesellschaftsethik
Nr. 2 (2012)Wir leben in »postdemokratischen« Zeiten, so heißt es nicht nur bei Colin Crouch:
Zwar bestehen in den westlichen Gesellschaften die demokratischen Institutionen
fort, zugleich nimmt aber die demokratische Partizipation und die Steuerung der
Gesellschaften von unten ab, die über diese Institutionen eigentlich sichergestellt
werden sollen. Für die Gesellschaftsethik ist diese Analyse hoch attraktiv: Diese
»braucht« eine anspruchsvolle normative Theorie der Demokratie als Kontrast zu
den postdemokratischen Verhältnissen, weswegen sich die Gesellschaftsethik gut
in das Gespräch über die »Postdemokratie« bringen kann. In Folge des zunehmen-
den Substanzverlust der Demokratie, sollte er unter dem Begriff ›Postdemokratie‹
gut eingefangen werden können, verliert die Gesellschaftsethik jedoch zugleich an
Rückhalt in der Realität, verliert die Möglichkeit, sich mit ihrem »Sollen« im »Sein«
demokratischer Gesellschaften abzusichern. Weil also eine doppelte Herausforderung,
stellt sich diese Ausgabe von »Ethik und Gesellschaft« der Diagnose der »Postdemo-
kratie«: Geprüft wird deren Realitätsgehalt, diskutiert wird deren gesellschaftsethische
Relevanz. Ein besondere Augenmerk wird auf die bürgerschaftliche Partizipation ge-
legt: Bestätigt das politische Engagement »in der Zivilgesellschaft« die Diagnose von
den »postdemokratischen« Zuständen, forciert sie womöglich diese Entwicklung sogar?
Oder ist sie eine Art »Gegengift« gegen den zunehmenden Verlust an demokratsicher
Partizipation und gesellschaftlicher Kontrolle »von unten«? -

Postwachstumsgesellschaft
Nr. 1 (2012)Obgleich die europäische Schuldenkrise die Klimaproblematik und die schwinden-
den Ressourcen aus den Schlagzeilen verdrängt, hat sich an der grundlegenden
Herausforderung, die Emissionen und den Materialdurchsatz der Weltwirtschaft
zu reduzieren, nichts geändert. Dabei ist die Debatte um eine Wirtschaft ohne
Wachstum im Diskurs der Ökonomen nach wie vor eher ein Außenseiterge-
schäft; und die Nachhaltigkeitsagenden werden zunehmend durch die Rhetorik
einer »green economy« ersetzt, die primär auf nationale Strategien der
Effizienzsteigerung setzt.
Dennoch wird in einigen Teilöffentlichkeiten intensiv über die künftige Ausrich-
tung der wirtschaftlichen Wohlstandsproduktion gestritten. Ist Wachstum bei
reduzierter Umweltbeanspruchung möglich oder muss die Wirtschaft – zumin-
dest in den Industrieländern – als ganze schrumpfen? Seit Ende 2010 werden
solche Diskussionen auch in einer eigenen Enquete-Kommission des Bundestags
geführt: »Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität – Wege zu nachhaltigem
Wirtschaften und gesellschaftlichem Fortschritt in der Sozialen Marktwirtschaft«.
An diese Debatten knüpft die Ausgabe 1/2012 von Ethik und Gesellschaft an. -
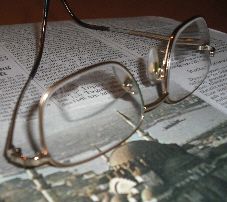
Religionsprojektionen
Nr. 2 (2011)Im Verhältniszu den jeweils anderen, den Muslimen, Christinnen, Atheisten, Jüdin-
nen und anderen können wir bei unseren Versuchen, diese zu verstehen, nicht
vermeiden, auf dem Boden unserer Kenntnisse von unseren Einstellungen auf die
ihren zu schließen. Gerade durch solche projektiven Konstruktionen über religiöse
oder weltanschauliche Einstellungen werden aber auch Probleme erzeugt: Islam-
feindschaft, Antimodernismus oder Antisemitismus gehören genauso dazu wie
Projektionen religiöser Perspektiven, Einstellungen und Praktiken, die aus der
Sicht einer sich als säkular und agnostisch verstehenden Politik, Philosophie oder
Kultur an Angehörige religiöser Gemeinschaften und Gruppen herangetragen wer-
den. Zur Debatte steht in diesem Heft damit auch das Verhältnis von religiöser/
weltanschaulicher Identitätund Liberalität bzw. von religiöser/weltanschaulicher
Identität und Offenheit für Differenz und Pluralität.
Religiös und weltanschaulich plurale Gesellschaften der Moderne bedürfen einer-
seits der Beschränkung religiöser Macht durch die Gewähr von Menschen- und
Grundrechten einschließlich negativer Religionsfreiheit, andererseits aber der Ge-
währ der Freiheit, Religion nicht nur im Privatleben auszuüben. Durch die wachsen-
de religiöse und weltanschauliche Pluralisierung wird bewusst, wie stark die deut-
sche Gesellschaft durch die christliche Kultur geprägt ist und wie sehr damit an-
dere Religionen und Kulturen um eine Gleichstellung gegenüber der westlichen
Kultur und der christlichen Religion kämpfen müssen. Auch die Grenzen zwischen
negativer Religionsfreiheit und positiver Religionsfreiheit verschieben sich.
Nur durch gegenseitiges besseres Kennenlernen und durch eine Beteiligung mög-
lichst vieler weltanschaulich differenter Positionen zu zuordnenden Akteuren an
öffentlichen Diskursen können diese Fragen so gelöst werden, dass das Nebenei-
nander der unterschiedlichen Orientierungen zur gegenseitigen Bereicherung wer-
den kann statt zum Anlass von Ausgrenzung und Diffamierung. Vielfältige Religions-
projektionen sowie Projektionen über Nicht-Religiosität stehen dem entgegen. -

Risiken und Nebenwirkungen – Ökonomisierungsfolgen im Gesundheits- und Sozialwesen
Nr. 1 (2011)Tendenzen zur Ökonomisierung werden schon seit längerer Zeit im Sozial- und Ge-
sundheitswesen thematisiert. Diese zeigen sich auf der einen Seite in den Bestre-
bungen, Soziale Arbeit, Pflege und auch die Medizin als »Dienstleistung« zu kon-
zeptionalisieren und in der Praxis daran auszurichten. Auf der anderen Seite werden
Gesundheitsleistungen zu »knappen Gütern«, über deren Verteilung und Finanz-
ierung erbittert gestritten wird. Schließlich machen ökonomische Tendenzen auch
vor schulischer, beruflicher und hochschulischer Bildung nicht halt: damit verän-
dern sich nicht nur Ziele und Inhalte der (Aus-)Bildung, die Veränderungen haben
auch Folgen für die Schülerinnen und Schüler sowie die Studentinnen und Studen-
ten.
Damit reichen diese Tendenzen weit über die Adaption betriebswirtschaftlicher Steu-
erungsinstrumente hinaus und nagen am Selbstverständnis der in den Feldern des
Gesundheits- und Sozialwesens beheimateten Professionen. So ergibt sich die Fra-
ge, was diese Entwicklungen bedeuten und wie sie ethisch einzuschätzen sind. Ver-
trägt sich die Vorstellung der Sozialen Arbeit oder der Pflege als »Dienstleistung«
mit Theorie und Praxis dieser Professionen? Welcher Art sind die »Produkte« dieser
Praktiken und wer bringt sie hervor? Ist die mit den Methoden der Qualitätssicher-
ung und des Qualitätsmanagements verbundene Technisierung dieser personen-
und körpernahen Tätigkeiten überhaupt leistbar – und ist sie ethisch vertretbar?
Wenn sich die Bereitstellung von Sozial- und Gesundheitsleistungen unter Knapp-
heitsbedingungen vollzieht müssen Kriterien ausgewiesen werden können, welche
die Verteilung dieser Güter rechtfertigen. Reichen dafür klassische Ansätze der
Verteilungsgerechtigkeit aus oder betrifft die Vorenthaltung entsprechender Güter
auch die Anerkennungsdimension? Die gegenwärtig zu beobachtenden Verschie-
bungen im Sozial- und Gesundheitswesen betreffen nicht allein die Oberfläche ihrer
verteilungstheoretischen Struktur, sie reichen in die Fragen des Selbstverständnis-
ses, nicht nur der involvierten Personen, sondern auch der Gesellschaft insgesamt. -

Sonderheft 2011 Arbeit – Eigentum – Kapital. Zur Kapitalismuskritik der großen Sozialenzykliken
2011Im Mai des Jahres 2011 standen gleich mehrere ›runde Geburtstage‹ großer päpst-
licher Sozialenzykliken auf der Tagesordnung: Rerum novarum wurde 120 Jahre,
Quadragesimo anno 80 Jahre, Mater et magistra 50 Jahre, Laborem exercens
30 Jahre und Centesimus annus 20 Jahre alt. Allerdings fand dieses ›Jubiläumsda-
tum‹ nicht nur in der säkularen, sondern auch in der innerkirchlichen Öffentlichkeit
nur eine überraschend geringe Resonanz. Die große Zeit der Sozialenzykliken und
der auf ihr beruhenden ›Katholischen Soziallehre‹ scheint ohnehin seit längerem vor-
bei zu sein. Dennoch sind in diesen Sozialrundschreiben bleibend wertvolle gesell-
schaftsethische Grundsatz-Reflexionen, bis heute gehaltvolle Ansätze normativer
Gesellschaftstheorie und zahlreiche, die herrschenden Plausibilitätsmuster der Ge-
genwartsgesellschaften produktiv irritierende Stellungnahmen zu finden, die eine
nähere Beschäftigung mit den Texten der päpstlichen Sozialenzykliken auch heute
noch lohnend macht. Zu einer voreiligen Verabschiedung dieser Tradition besteht je-
denfalls genau so wenig Anlass wie zu ihrer geflissentlichen Nichtbeachtung.
Das ›Sonderheft 2011‹ der ›Ethik und Gesellschaft‹ stellt sich deshalb die Aufgabe,
zentrale Themen und Motive der langen Tradition päpstlicher Sozialverkündigung in
der modernen kapitalistischen Industriegesellschaft noch einmal Revue passieren
zu lassen und auf ihre Zukunftspotenziale hin zu befragen. Dieses Anliegen ist im
›Jubiläumsjahr 2011‹ auch deshalb angesagt, weil es seit der im Herbst 2008 aus-
gebrochenen Wirtschafts- und Finanzkrise wieder ein neues politisch-publizistisches
Interesse am Thema der Kapitalismuskritik gibt, wobei über die Fragen ihrer Mög-
lichkeiten und Chancen, ihrer Ausmaße und Profile erhebliche Uneinigkeit herrscht.
Grund genug also, auf der Grundlage der großen päpstlichen Sozialenzykliken nach
Traditionen, Aufgaben und Perspektiven kirchlicher Kapitalismuskritik ›im Blick zu-
rück nach vorn‹ zu fragen.
Die Texte dieser Ausgabe sind entstanden im Rahmen der ›1. Heppenheimer Tage
zur christlichen Gesellschaftsethik‹, die am 20. und 21.05.2011 in Kooperation mit
dem Institut für Theologie und Sozialethik (iths) der TU Darmstadt im ›Haus am Mai-
berg‹ stattfanden, der Akademie für politische und soziale Bildung des Bistums Mainz.
Die ›Heppenheimer Tage‹ zielen darauf, die Traditionen der katholischen Soziallehre
mit den Theoriedebatten der zeitgenössischen Sozialwissenschaften ins Gespräch zu
bringen. Sie widmen sich in diesem Sinne der Verständigung und Weiterentwicklung
zentraler Anliegen der christlichen Gesellschaftsethik. Den Mitarbeitern des Hauses
sei an dieser Stelle für die angenehme und unkomplizierte Tagungsatmosphäre eben-
so gedankt wie den Teilnehmerinnen und Teilnehmern für ihre produktiven Debatten-
beiträge, ohne die die hier vorgelegten Texte in dieser Form wohl kaum zustande ge-
kommen wären. -

Der ganz alltägliche Rassismus
Nr. 2 (2010)Gebannt und erschrocken schauen wir nach »rechts«, erschaudern über Aufläufe
von Neonazis und über rechte Gewalt gegen Ausländerinnen und Ausländer. Doch
die Geisteshaltung und die Einstellungen »dahinter« sind keine Sachverhalte nur
am Rande, sondern sind in der Mitte der Gesellschaft zu finden. Gleichgültig, ob
man sie mit ›Rassismus‹ oder anderen Begriffen benennt, die stereotypisierende
Auszeichnung von Unterschieden, die Abwertung derer, denen diese Unterschiede
zugerechnet werden, und politische Aktivitäten, soziale Zusammenhänge über der-
artige stereotypische Unterscheidungen zu ordnen, bestimmen die bundesdeutsche
Gesellschaft – und zwar weit über den Kreis der Menschen hinaus, die sich in rechts-
radikalen Vereinigungen und Parteien organisieren. Auch Christen und die Kirchen
sind davon nicht ausgenommen. Im Gegenteil: Zum Beispiel über ihre »Abwehr« des
Islams im eigenen Land bedienen auch Christen einen gesellschaftlich tolerierten Anti-
islamismus, mehr noch: forcieren ihn und besorgen ihm gesellschaftliche Akzeptanz.
In diesen und anderen Fällen dienen christliche Einstellungen und Überzeugungen als
Grund für stereotypische Zuschreibungen, Abwertungen und Ausgrenzungen von ver-
meintlich abweichenden, gefährlichen Einstellungen und Überzeugungen anderer. Mit
dieser Ausgabe stellt sich »Ethik und Gesellschaft« die Frage, ob und wie sich der all-
tägliche Rassismus unter Christen und in ihren Kirchen »eingenistet« hat und ob und
wie die im Christentum und in den Kirchen »heimischen« rassistischen Einstellungen
und Überzeugungen den bestehenden Alltagsrassismus fördern. Da sich der im Chris-
tentum heimische Rassismus – gegenüber »dem Islam« – auch der Gleichberechti-
gung von Frauen bedient, obgleich die häufig gegen das Christentum und die Kirchen
erkämpft werden musste und muss, wird auch nach der Relevanz dieses Arguments
für den Alltagsrassismus gefragt. Wenngleich unter Christen verbreitet, ist Rassismus
Häresie – die Bestreitung genau dessen, was Christen von dem im Christentum über-
lieferten Gott erhoffen: Das Heil für alle Menschen. -

»Wem gehört die ›Soziale Marktwirtschaft‹?« Herkunft und Zukunft einer bundesrepublikanischen Erfolgsformel
Nr. 1 (2010)Die bundesrepublikanischen Feierlichkeiten zu »60 Jahre Soziale Marktwirtschaft« aus
dem Sommer 2008 waren kaum ausgeklungen, als wir im Herbst von der großen Wirt-
schafts- und Finanzkrise überrascht wurden; einer Krise, in der zunehmend deutlich
wurde, dass die in der Publizistik soeben noch emphatisch gepriesene Erfolgsgeschich-
te der Sozialen Marktwirtschaft vielleicht gar nicht so erfolgreich war, wie man meinte.
Jedenfalls ist heute unübersehbar, dass die real bestehende Soziale Marktwirtschaft in
breiten Teilen der Bevölkerung nur noch wenig Vertrauen genießt und durch die vor-
herrschende Wahrnehmung, dass es »im Lande nicht mehr sozial gerecht zugeht«,
unter erheblichen Legitimationsdruck gerät.Was unter Sozialer Marktwirtschaft aber genau zu verstehen ist, genauer gesagt: was
das Soziale an der Sozialen Marktwirtschaft ist und wie bzw. von wem dieses Soziale
konstituiert und garantiert werden soll, ist dabei durchaus unklar; und zwar nicht erst
heute, sondern schon vor 60 Jahren. Die Wahrnehmungen und Interpretationen in
Wissenschaft, Politik und Publizistik, in Unternehmerverbänden, Gewerkschaften und
Kirchen unterscheiden sich hier nicht selten ganz erheblich. Und es ist deshalb an der
Zeit der Frage nachzugehen, ob wir eigentlich alle dasselbe meinen, wenn wir von der
Sozialen Marktwirtschaft reden.Vor diesem Hintergrund widmete sich im Januar 2010 die Jahrestagung der »Ökume-
nischen Arbeitsgemeinschaft sozialethischer Institute« (ÖASI) – ein im Jahr 2001 ge-
gründeter Zusammenschluss verschiedener christlich-sozialethischer Forschungsin-
stitute, die in ökumenischer Perspektive die Interaktion und Kooperation innerhalb
des Faches verbessern will – dem Thema: Wem gehört die Soziale Marktwirtschaft?
Herkunft und Zukunft einer bundesrepublikanischen Erfolgsformel. Auf dieser Ta-
gung sollte es vor allem um das in den letzten Jahren in der vergleichenden Wohl-
fahrtsstaatsforschung deutlich gewachsene theoretisch-systematische Interesse an
den lange Zeit wenig thematisierten »konfessionellen Wurzeln« der Konzeption einer
Sozialen Marktwirtschaft gehen. Dabei stand insbesondere die Frage im Raum, in-
wiefern sich die politisch-moralischen Grundlagen des deutschen Wirtschafts- und
Sozialmodells gewissermaßen als »interkonfessioneller Kompromiss« (Philip Manow)
zwischen einem eher sozialstaatskritischen Lager protestantisch-ordoliberaler Pro-
venienz einerseits und einem vor allem am Sozialversicherungsstaat orientierten
katholisch-»rheinischen« Lager andererseits beschreiben lassen.Die Ausgabe 1/2010 der »Ethik und Gesellschaft« präsentiert Texte und Kommentare,
die aus dieser Tagung hervorgegangen sind. Sie will damit eingreifen in die Debatten
um das politisch-moralische Selbstverständnis dessen, was »Soziale Marktwirtschaft«
ist und sein soll; und sie will in historisch-systematischen Vergewisserungen der Frage
nachgehen, inwiefern diese »konfessionellen Wurzeln« – womöglich in hochgradig sä-
kularisierter Form – für die aktuellen Krisen- und Regenerierungsdebatten um »unsere
Soziale Marktwirtschaft« auch heute noch relevant sind. Die Tatsache, dass die ver-
schiedenen Beiträge dieses Heftes hier zu kontroversen Einschätzungen gelangen,
macht deutlich, dass diese Frage allemal aktuell ist und wohl auch bleiben wird. -

Nach dem Kollaps - (Finanz-)Ethische Schlussfolgerungen aus der Krise
Nr. 2 (2009)Die globale Finanzkrise ist die Krise einer neuen Form der Finanzwirtschaft. Die Besonderheiten dieser neuen Form von »finance« sowie die Ursachen und finanzwirtschaftlichen Folgen der Krise lassen sich auf verschiedenen Ebenen beschreiben: auf der Mikroebene der Interaktionen und Handlungsmotive der Individuen, auf der Makroebene der Branche, der Gesamtwirtschaft und der Gesellschaft sowie auf der Mesoebene der Organisationen, der Milieus und des Berufs-Ethos der »Banker«. Die ersten beiden Beiträge dieser Ausgabe von Ethik und Gesellschaft setzen auf der Mesoebene an. Sie untersuchen Entwicklungen in den organisatorischen Strukturen der Finanzinstitute und im professionellen Ethos des Investmentbanking. Der dritte und der vierte Beitrag sind der Makroebene gewidmet. Hier wird nach den Besonderheiten der heutigen Form von »finance« sowie ihren gesamtwirtschaftlichen und gesamtgesellschaftlichen Auswirkungen gefragt. Der vierte Beitrag rückt dabei wirtschaftskulturelle Aspekte, insbesondere die Frage nach den Beziehungen zwischen den Partnern finanzwirtschaftlicher Transaktionen in den Vordergrund. Insofern leitet er zum letzten Beitrag über, in dem auf der Mikroebene das Motiv des »mehr Wollens« philosophisch beleuchtet wird. -

Bildung, Gerechtigkeit und Kompetenz
Nr. 1 (2009)Wer gegenwärtig nicht über die Finanzkrise spricht, redet über Bildung.
Bildungsparteitage und Bildungsgipfel wechseln sich ab; Bildungsgutachten
sind in Mode. Auch die Evangelische Kirche in Deutschland betont, in ihrer
letzten Armutsdenkschrift, wie wichtig Bildung für die Bekämpfung von Armut
und Arbeitslosigkeit ist. In ganz Deutschland schießen Bildungspläne wie
Pilze aus dem Boden; Wertevermittlung gilt dabei regelmäßig als eine der
vornehmsten Aufgaben. Wer momentan über Bildung redet, macht also nichts
falsch. Grund genug für »Ethik und Gesellschaft«, an dieser Stelle einzuhaken,
und sich in zweierlei Hinsicht mit den Feinheiten von Bildung, Gerechtigkeit und
Kompetenz zu beschäftigen: einerseits unter der Fragestellung, wie Bildung und
Verteilungsgerechtigkeit sich eigentlich zueinander verhalten, andererseits unter
dem Aspekt, inwiefern Bildungsinhalte Gerechtigkeit fördern können. -

Rückkehr der Vollbeschäftigung oder Einzug des Grundeinkommens?
Nr. 2 (2008)Zumal angesichts des durch die Finanzkrise induzierten Konjunkturknicks
ist politisch kaum strittig, dass zur arbeitsgesellschaftlichen Formation der
»goldenen« fünfziger und sechziger Jahre, mit ihrer Art von Vollbeschäftigung,
kein Weg zurückführt. Wiewohl auch nicht von einem Ende der Arbeitsgesell-
schaft die Rede sein kann, befindet sich diese in einem heftigen Umbruch.
Noch ist nicht ausgemacht, welche Perspektiven und Horizonte dieser Umbruch
eröffnet – oder androht. -

Politik aus dem Glauben
Nr. 1 (2008)Vor einigen Jahrzehnten schrieb Dorothee Sölle gegen die Verdrängung
des Glaubens aus der Praxis - wenn die Praxis als Frucht des Glaubens
theologisch verkannt wird. Zeitgleich warb Johann Baptist Metz für die
politisch-mystische Doppelstruktur christlichen Glaubens in der Nachfolge
Jesu. Gut vier Jahrzehnte später fragt e+g, unter deutlich veränderten gesell-
schaftlichen Bedingungen, nach dem innigen Verhältnis von Glauben und
politischem Engagement. -

Prekariat
Nr. 1 (2007)Das Prekariat wurde entdeckt - und zum Objekt sozialstaatlicher Inklusions-politiken gemacht. Die Sozialethik, die sich zunehmend unter den Grundsatz der
Beteiligungsgerechtigkeit stellt, findet daran ihr Wohlgefallen: Die Menschen, die nicht wie alle anderen zur Gesellschaft dazugehören, denen deshalb vergleich-
bare Beteiligungschancen verwehrt werden, werden ins Zentrum sozialpolitischer Aufmerksamkeit gerückt. Der bundesdeutsche Sozialstaat wird vorrangig diesen Menschen und ihrer Inklusion gewidmet, deshalb mit seinen Sicherungs- und Fürsorgesystemen in Richtung von Aktivierung und Befähigung umgebaut. Doch bei näherem Hinsehen entpuppen sich die neue Aufmerksamkeit für das Prekariat und damit auch das neue sozialstaatliche Inklusions und Aktivierungsprogramm als äußerst zweischneidig: Erst mit seiner »Entdeckung« wird das Prekariat gemacht - und es wird zugleich politisch benutzt. Dadurch, dass der Sozialstaat mit seiner
Inklusion beschäftigt wird, landen die »Hilfebedürftigen« genau dort, wo sie der Analyse ihrer Hilfebedürftigkeit zufolge sind, »außerhalb« der Gesellschaft und ohne vergleichbare Beteiligungschancen. Geboten ist daher eine kritische Sicht auf die neue Sozialpolitik, ihrem herausragenden Interessen am Prekariat und das Programm »Fordern und Fördern«.